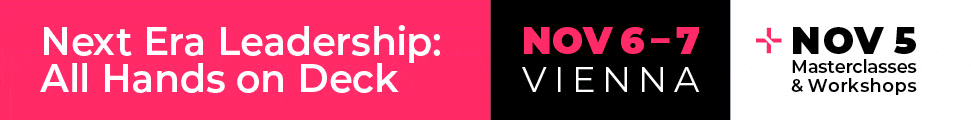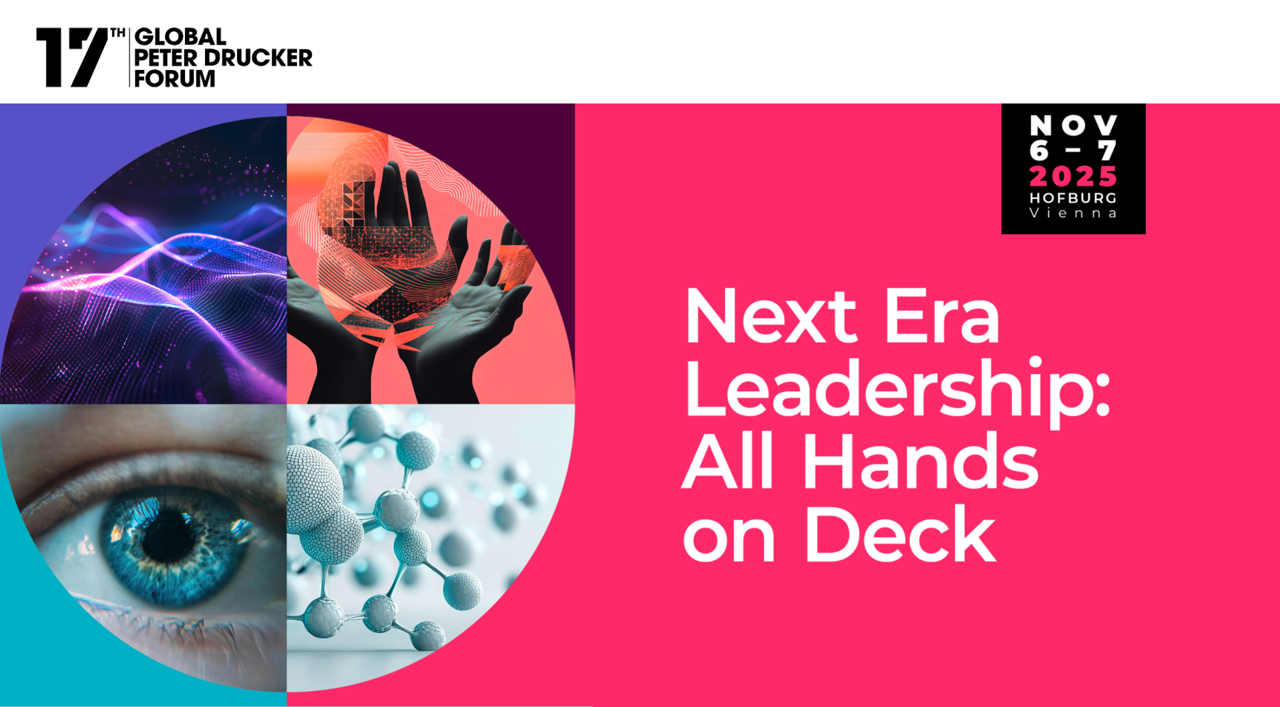Vertrauen ist die Basis guter Geschäfte. Insbesondere das Vertrauen in die Informations- und Datensicherheit ist im Zeitalter der Digitalisierung eine Grundvoraussetzung für Wachstum und Konjunktur. Ausufernde staatliche Überwachungsphantasien zerstören dieses Vertrauen – und schaden der gesamten Weltwirtschaft, wie ein Blick in die jüngere Geschichte offenbart.
“Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten“, lautet das bewährte Killerargument aller „Law and Order“-Fetischisten, die Sicherheitsbehörden möglichst weitreichende Überwachungsbefugnisse an die Hand geben wollen. Ein besonders fieses Argument, denn wer dagegen aufmuckt, macht sich a priori selbst verdächtig. Ist da einer etwa nervös, weil er selbst Leichen im Keller hat?
Noch vor seiner Sommerpause hat der österreichische Nationalrat die lang umstrittene „Messenger- Überwachung“ beschlossen, mit viel Bauchweh, selbst in den Reihen der Regierungskoalition. Zwei NEOS-Abgeordnete, sowie beide Oppositionsparteien stimmten dagegen. Die FPÖ ortet umfassende „Überwachungsphantasien“, und die Grünen befürchten die rechtswidrige und missbräuchliche Verwendung von ausgelesenen Handydaten. Dennoch: Erfahrungen wie die terroristischen Anschläge von Wien und Villach oder der vereitelte Anschlag auf das Taylor-Swift-Konzert scheinen die Widerstände in Politik und Gesellschaft auch hierzulande zusehends aufgeweicht zu haben.
Das gezielte „Abhören“ konkret Verdächtiger mit richterlicher Genehmigung ist an sich nichts Neues und schon lange Teil des österreichischen Rechtsbestands. Neu ist, dass es jetzt um verschlüsselte Nachrichten geht. Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Signal bieten ihren Kunden eine so genannte „Ende-zu-Ende“-Verschlüsselung. (siehe Infokasten „Messenger-Dienste“). Der hohe Verschlüsselungsstandard macht es technisch praktisch unmöglich, Nachrichten auf dem Weg vom Sender zum Empfänger mitzulesen. Es muss eine Spionagesoftware, ein sogenannter „Trojaner“, direkt auf einem der Endgeräte eingeschleust werden, um die unverschlüsselten Nachrichten auslesen zu können. Werden solche Spionagetools vom Staat eingesetzt, bezeichnet sie der Volksmund gern auch als „Bundestrojaner“.
Wir alle haben etwas zu verbergen
Und darin liegt das rechtsstaatliche Problem: Wie sicherstellen, dass mit der Software nicht nur der fragliche Kommunikationskanal, für den die richterliche Überwachungsbefugnis gilt, ausgelesen wird, sondern der gesamte Smartphone-Inhalt inklusive aller Kontaktdaten, was nicht nur möglich, sondern technisch teilweise sogar unumgänglich ist, meinen Experten. Auf diese Weise könnten Persönlichkeits- und Datenschutzrechte verletzt werden und schnell auch unschuldige Dritte in den Ermittlungsfokus geraten. Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten? Von wegen!
Ist es verdächtig, wenn man etwas verbergen möchte? Zunächst einmal haben wir das in der Verfassung verbriefte Recht, etwas zu verbergen, nämlich unsere Privatsphäre. Und dann gibt es ganze Berufsgruppen und Branchen, die von Rechts wegen oder aus Geschäftsinteresse etwas zu verbergen haben: Anwälte die Informationen über ihre Mandanten, Ärzte ihre Patientendaten, Journalisten ihre Recherchen und Informanten, Banken die Finanz- und Transaktionsdaten ihrer Kunden und Firmen aller Art ihre erfolgsrelevanten Geschäftsgeheimnisse, aber auch die Daten ihrer Geschäftspartner, Kunden und Mitarbeitenden, et cetera.
Text: Xenia Bauer-Neuhaus
Infokasten
Die Geschichte verschlüsselter Messenger-Dienste
Vorreiter bei „smarten“ Mobility-Technologien war in den 2000er-Jahren Blackberry. Die Geräte und Dienste waren vor allem für den Einsatz im Geschäftsleben ausgelegt. Der kanadische Anbieter versprach seinen Business-Kunden unter anderem eine garantiert abhörsichere Kommunikation mit Hilfe eines „militärischen“ Verschlüsselungsstandards. Firmen in aller Welt waren begeistert und erhofften sich einen Durchbruch in Sachen Mobilität, Flexibilität und letztlich Produktivität ihrer Geschäftsprozesse. Endlich konnten ihre Manager und Außendienstmitarbeiter von überall aus sicher auf das Firmennetz zugreifen, geschäftliche E-Mails lesen und sich über den „Blackberry Messenger“ austauschen.
Genauso begeistert über die neue abhörsichere Kommunikationsmöglichkeit waren aber auch terroristische Organisationen und die organisierte Kriminalität. Bei Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten in aller Welt schrillten die Alarmglocken. Einige Länder, allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate, drohten Blackberry sogar mit einem Verbot, sollten ihnen die Kanadier keine „Hintertür“ in die verschlüsselte Kommunikation ihrer Kunden öffnen.
So viel zur gefühlt grauen Vorzeit, denn heute, 15 Jahre später, haben mobile Technologien und Smartphones nicht nur das Business, sondern die gesamte Gesellschaft buchstäblich bis in die finstersten Winkel durchdrungen. Und Blackberry wurde von viel größeren, globalen Tech-Konzernen vom Markt gefegt.
Lesen Sie auch die weiteren Kommentare zum Thema:
Von Pegasus bis zur NSA: Was der digitale Überwachungsstaat wirklich bedeutet
Cloud, Kontrolle und Konzerne – Wie sicher sind unsere Daten wirklich?