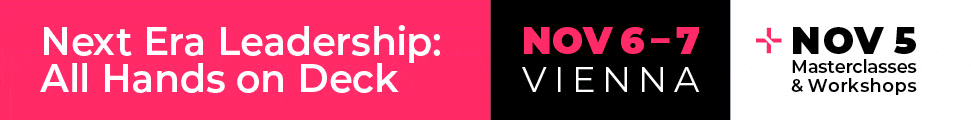Die Value in Motion-Studie von PwC analysiert die wirtschaftlichen Auswirkungen der Megatrends Künstliche Intelligenz (KI) und Klimawandel. Demnach kann eine vertrauensbasierte, breit akzeptierte Nutzung von KI das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis 2035 um bis zu 15 Prozentpunkte steigern – ein Wachstumsimpuls vergleichbar mit dem der industriellen Revolution.
Gleichzeitig warnen die Studienautoren vor den negativen Effekten des Klimawandels: Klimarisiken könnten das globale Wirtschaftswachstum im selben Zeitraum um bis zu 7 Prozentpunkte schrumpfen lassen. Damit wäre eine Überkompensation der Klimafolgen durch KI möglich – allerdings nur, wenn Politik und Unternehmen das gesellschaftliche Vertrauen in KI-Technologien deutlich stärken und branchenübergreifende Ökosysteme fördern.
Vertrauen als Schlüsselfaktor
Die Studie unterscheidet drei Szenarien: „Trust-based transformation“, „Tense transition“ und „Turbulent times“. Im optimistischen Szenario mit hohem Vertrauen in KI und intensiver, branchenübergreifender Kollaboration entfaltet KI ihr volles Wachstumspotenzial. Fehlt dieses Vertrauen und bleibt die Zusammenarbeit aus, reduziert sich der zusätzliche Wachstumsschub in Deutschland auf lediglich 7 Prozentpunkte (global: 8 Prozentpunkte), im ungünstigsten Fall sogar auf 3 Prozentpunkte (Deutschland) beziehungsweise 1 Prozentpunkt global.
Rudolf Krickl, CEO von PwC Österreich, betont: „Das Potenzial von KI macht eine Überkompensation der Klimarisiken trotz steigenden Energiebedarfs möglich – vorausgesetzt, Politik und Unternehmen schaffen es rasch, das Vertrauen der Gesellschaft in die Technologie zu stärken.“
Transformation und Wertschöpfung
Die Weltwirtschaft steht vor einer tiefgreifenden Transformation. Allein 2025 werden laut Studie weltweit etwa 7,1 Billionen US-Dollar an Wertschöpfung zwischen Unternehmen und Branchen verlagert. Unternehmen, die sich flexibel in vernetzten Ökosystemen bewegen, sind im Vorteil. Ökosysteme, die sich weniger an klassischen Branchengrenzen orientieren, entstehen etwa im Mobilitätssektor, wo Autohersteller, Energieunternehmen, Batterieproduzenten und Technologiefirmen enger zusammenarbeiten.
„Geopolitische und wirtschaftliche Spannungen erschweren die kurzfristige Planung – ändern jedoch nichts an den langfristigen Trends“, so Krickl. „Technologische Innovation, Klimawandel und neue Konsumgewohnheiten bestimmen weiterhin, wie Unternehmen Wert schaffen.“
Technische und gesellschaftliche Herausforderungen der KI
Die zunehmende Verbreitung von KI führt zu einem höheren Energieverbrauch, insbesondere in Rechenzentren. Die Studie zeigt jedoch, dass durch Innovationen im Bereich der Energieeffizienz – etwa durch KI selbst – der zusätzliche Energieverbrauch ausgeglichen werden könnte. Entscheidend ist dabei, dass jeder zusätzliche Prozentpunkt Wirtschaftswachstum durch KI auch zu Innovationen führt, die die Energieintensität senken.
Für Unternehmen bedeutet dies, sich mit den technischen, gesellschaftlichen und regulatorischen Herausforderungen der KI-Transformation auseinanderzusetzen. Vertrauenswürdige, nachvollziehbare und ethisch verantwortungsvolle KI-Anwendungen sind Grundvoraussetzung für nachhaltiges Wachstum. Nur so können die Chancen der KI die negativen Folgen des Klimawandels überkompensieren.