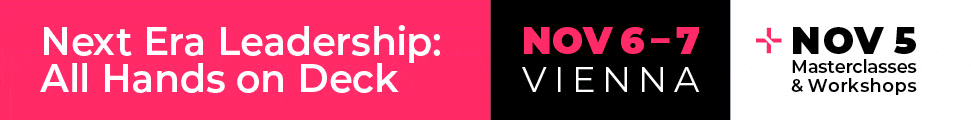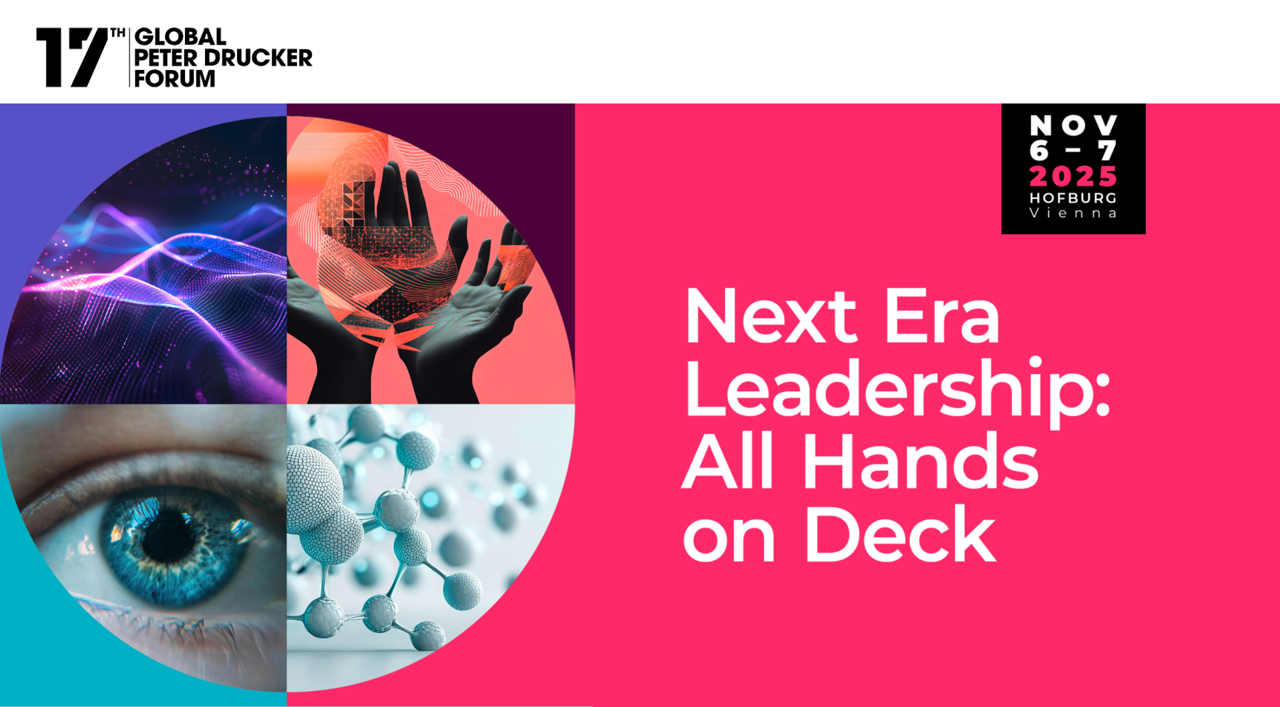Europa steht vor einer entscheidenden Herausforderung: Wie können Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft enger zusammenarbeiten, um Innovationen schneller und effektiver voranzutreiben? Im Rahmen des Peter Drucker Forums, das kürzlich in der Wiener Hofburg stattgefunden hat, diskutierten Experten darüber, wie diese Kluft zwischen Forschung und Praxis überwunden werden kann. xBN hat mit Georg Kopetz, CEO und Mitgründer des heimischen High-Tech-Unternehmens TTTech, unter anderem darüber gesprochen, welche Rolle Kapitalmärkte und Unternehmertum dabei spielen und warum ein Zusammenspiel von „Minds On“ und „Hands On“ essenziell ist, um Europas Innovationskraft nachhaltig zu stärken.
Beim Drucker Forum stand die Diskussion über Innovation und den Transfer von Wissenschaft in Technologie im Mittelpunkt. Wie können Wissenschaft und Technologie effektiver zusammenarbeiten, um Innovationen schneller und fundierter voranzutreiben?
Peter Drucker thematisierte bereits 1962 in seinem Essay „Science and Technology“ das Wechselspiel zwischen Wissenschaft und Technologie. Er stellte fest, dass viele technologische Innovationen oft lange vor ihrer wissenschaftlichen Erklärung entstanden. Ein prägnantes Beispiel ist die Dampfmaschine von James Watt: Sie wurde patentiert, bevor die thermodynamischen Prinzipien, die sie beschreiben, verstanden waren – ein Verständnis, das erst 75 Jahre später durch die Arbeiten von Lord Kelvin und anderen entwickelt wurde. Es dauerte also Jahrzehnte, bis die Wissenschaft die physikalischen Grundlagen der Technologie nachvollzog.
Ein ähnliches Phänomen beobachten wir heute bei der künstlichen Intelligenz. Praktische Anwendungen wie Deep Neural Networks, Large Language Models und Foundation Models haben die wissenschaftliche Kompetenz in vielen Bereichen überholt. Die Technik schreitet in rasantem Tempo voran, während die Wissenschaft oft erst nachträglich versteht, warum und wie diese Technologien funktionieren. Dies verdeutlicht die essenzielle Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Anwendungstechnik und Grundlagenforschung.
Wie kann Europa Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft enger verknüpfen, um Innovationen effizienter zu fördern und seine Wettbewerbsfähigkeit auszubauen?
Europa verfügt über einen enormen Reichtum an hochqualifizierten Wissenschaftlern. Doch häufig arbeiten sie isoliert in spezialisierten Forschungsrichtungen oder an Universitäten, ohne regelmäßig mit den Anforderungen der Praxis konfrontiert zu werden. Um Innovationen voranzutreiben, müssen wir Räume schaffen, in denen der Austausch zwischen Wissenschaftlern und Technologieexperten gefördert wird – eine „collision of ideas“, bei der neue Ansätze und Lösungen entstehen.
Ein weiterer zentraler Faktor ist der Business-Aspekt. Nach Peter Drucker gibt es zwei Kernfunktionen eines Unternehmens: Innovation und Marketing. Innovation bedeutet nicht nur, neue Technologien zu entwickeln, sondern diese auch erfolgreich zu skalieren und am Markt zu etablieren. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie ein langfristiges Engagement und ein innovationsfreundliches Mindset.
Aktuell klafft in Europa eine Lücke zwischen wissenschaftlicher Forschung und technischer Anwendung. Diese zu schließen ist essenziell, um die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union zu stärken. Die Frage ist, wie wir unsere wissenschaftliche Basis besser nutzen können, um unternehmerische Ambitionen zu fördern, den Technologietransfer zu beschleunigen und Europa in einem globalen Wettbewerb erfolgreicher zu positionieren.
Wie kann Europa diese Kluft überbrücken?
Auf dem Podium war auch der Leiter von JEDI, der Joint European Disruption Initiative, vertreten. Diese Organisation hat das Ziel, disruptive Innovationen schnell in den Markt zu bringen. Ich habe mich insbesondere dafür ausgesprochen, dass das kommende Forschungsrahmenprogramm FP10 – das für die nächste Generation ab 2027 geplant ist – konkrete Maßnahmen zur Förderung von Wettbewerbsfähigkeit umsetzt. Ein Beispiel hierfür ist der vorgeschlagene Competitiveness Fund, der auf den Empfehlungen des Trage-Reports basiert.
Solche Initiativen sind vielversprechend, doch es ist entscheidend, dass sie von Fachleuten geleitet werden, die direkt im „Science-to-Technology-to-Business“-Umfeld tätig sind. Eine theoretische Herangehensweise allein reicht hier nicht aus. Die Kluft zwischen Praktikern, die im globalen Wettbewerb bestehen müssen, und Forschern, die in relativ abgesicherten Umgebungen arbeiten, bleibt nach wie vor groß. Diese zwei Welten voneinander zu entfremden, ist kontraproduktiv. Stattdessen sollten wir ein besseres Verständnis füreinander schaffen.
Es geht nicht darum, dass Wissenschaftler den gleichen Druck wie Unternehmer erleben müssen. Aber sie sollten die Herausforderungen des globalen Wettbewerbs nachvollziehen können. Gleichzeitig erfordert der zunehmende Wettbewerb mehr Kooperation und Unterstützung innerhalb Europas. Ein gemeinsamer Ansatz ist entscheidend, um unsere Ziele effektiver zu erreichen und die Innovationskraft des Kontinents zu stärken.
Das zentrale Problem ist, dass Themen wie Technologie, IT, Kapitalmärkte und Börse oft nicht ausreichend verstanden werden. Es fehlt an Menschen, die einerseits das notwendige Fachwissen besitzen und andererseits den Mut haben, diese Themen öffentlich zu vertreten.

Oft wird der Fokus auf Dinge gelegt, die nicht gut laufen. Es ist jedoch genauso wichtig, über erfolgreiche europäische Flaggschiffprojekte zu sprechen, die beweisen, was in Europa möglich ist. In der aktuellen geopolitischen Lage wird immer deutlicher, dass Europa unabhängiger werden muss – vor allem von Technologien aus China oder den USA. Das erfordert, dass wir unsere Kompetenzen und unser Know-how besser bündeln und strategisch auf den Markt bringen.
Ich bin überzeugt, dass Europa in Zukunft deutlich mehr Eigeninitiative in strategischen Technologiebereichen wie Verteidigung und Satellitenkommunikation zeigen wird. Es kann nicht sein, dass wir noch immer kein eigenständiges, europäisches Satellitennetzwerk aufgebaut haben. Dennoch sehe ich ein grundlegendes Problem: Wir neigen dazu, mehr zu jammern als aktiv zu handeln.
Wie kann Europa gezielt privates Kapital mobilisieren, um strategische Technologien zu fördern und die Wertschöpfung in der Region zu sichern?
Ein Anliegen, das ich auch in meiner Funktion im österreichischen Rat für Forschung, Technologie und Innovation Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung vorantreibe, ist die Etablierung eines Dachfonds. Dieser Fonds könnte in Technologiefonds investieren, um langfristiges Kapital für Wachstums- und Transformationsunternehmen bereitzustellen – insbesondere in den Bereichen Technologie und Energie. Solches „Long-Term-Patient-Capital“ fehlt in Europa bisher.
Gleichzeitig ist es essenziell, Brücken zwischen Wissenschaft und Technologie zu bauen, Universitäten stärker einzubinden und den Austausch zu fördern. Auch im Bereich der Finanzierung müssen wir strategischer denken. Dabei sollte der Staat nicht allein beurteilen, wo investiert wird, sondern vor allem privates Kapital stärker motivieren, in innovative Technologien zu fließen. Aktuell fehlt vielen Investoren jedoch der Bezug zur Technologie, IT und Digitalisierung. Stattdessen investieren sie lieber in US-Technologieindizes und profitieren von der Wertschöpfung, die primär in den USA stattfindet.
Das ist ein grundlegendes Missverständnis: Wertschöpfung entsteht dort, wo auch investiert wird. Diese Diskrepanz, die Schizophrenie, dass wir Kapital exportieren und gleichzeitig über fehlende Innovationskraft in Europa klagen, müssen wir überwinden. Nur durch gezielte Investitionen und eine langfristige Strategie können wir Europas Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken.
Woran liegt es, dass Europa in einigen Schlüsselbereichen wie Technologie, IT und Finanzierung nicht schneller Fortschritte macht? Ist es eine Frage des Mindsets oder unseres universitären Umfelds? Wie können wir in Europa das Bewusstsein für die Bedeutung von Technologie und Kapitalmärkten stärken und die gesellschaftliche Akzeptanz für notwendige Innovationen fördern?
Meiner Meinung nach liegt es vor allem daran, dass die Botschaft zu wenig kommuniziert wird. Es geht darum, diese Themen immer wieder in den Fokus zu rücken. Veränderung passiert nicht von allein – sie braucht kontinuierliches Engagement und Kommunikation. Wenn niemand darüber spricht, wird sich nichts bewegen.
Was die Unterstützung durch die Regierung betrifft, bin ich grundsätzlich optimistisch. Alle Regierungsmitglieder, unabhängig von der Parteizugehörigkeit, haben in der Vergangenheit Unterstützung signalisiert. Allerdings reicht das allein nicht aus. Es braucht konkrete Aktionen – und dafür ist ein gesellschaftlicher Konsens entscheidend. Solange die Bevölkerung technologische und finanzielle Fragen nicht als dringende Probleme wahrnimmt, werden entscheidende Maßnahmen ausbleiben.
Das zentrale Problem ist, dass Themen wie Technologie, IT, Kapitalmärkte und Börse oft nicht ausreichend verstanden werden. Es fehlt an Menschen, die einerseits das notwendige Fachwissen besitzen und andererseits den Mut haben, diese Themen öffentlich zu vertreten. Allerdings entwickelt sich in Europa aktuell ein positives Umfeld: Besonders im Bereich Unternehmertum entstehen vielversprechende Technologie-Ökosysteme. In den vergangenen Jahren haben Unternehmen beachtliche Größenordnungen erreicht und stehen nun vor der Herausforderung, Kapitalmärkte für ihren nächsten Wachstumsschritt zu nutzen.
Ich denke, der Druck wird nicht nur national, sondern auch von europäischen Partnern wie München Deutschland weiter steigen, hier aktiv zu werden. Eine engere Zusammenarbeit mit unseren europäischen Bündnispartnern ist essenziell, um langfristig erfolgreich zu sein.
Welche Hindernisse gilt es zu überwinden?
In Europa und speziell in Österreich gibt es nach wie vor zu wenige Fachkräfte im Bereich Technologie und IT, die über das notwendige Verständnis und Know-how verfügen, um Innovationen voranzutreiben. Viele Unternehmen hierzulande sind Tochtergesellschaften internationaler Konzerne, deren zentrale Finanzierungsentscheidungen anderswo getroffen werden. Wirklich eigenständige Headquarters in Wien oder anderen Städten sind selten.
Ein weiteres Hindernis ist das Fehlen von Role Models, die Orientierung bieten und Nachahmung anregen könnten. Österreich hat zweifellos einige erfolgreiche Start-ups hervorgebracht, doch diese erreichen irgendwann eine Wachstumsgrenze. An diesem Punkt braucht es die nächste Stufe: die Skalierung. Scale-ups spielen eine entscheidende Rolle, denn sie sollten wiederum in den frühen Phasen neuer Technologien und Innovationen investieren. Doch dafür benötigen sie eine geeignete Finanzierung.
In Europa und speziell in Österreich gibt es nach wie vor zu wenige Fachkräfte im Bereich Technologie und IT, die über das notwendige Verständnis und Know-how verfügen, um Innovationen voranzutreiben. Viele Unternehmen hierzulande sind Tochtergesellschaften internationaler Konzerne, deren zentrale Finanzierungsentscheidungen anderswo getroffen werden. Wirklich eigenständige Headquarters in Wien oder anderen Städten sind selten.
Die Erwartungen an Scale-ups sind häufig kurzfristig orientiert: Sie sollen Cashflows generieren und Dividenden ausschütten. Dabei wäre es entscheidend, langfristig zu denken und Gewinne in die nächste Generation von Technologien zu reinvestieren. Dies setzt jedoch einen funktionierenden Kapitalmarkt voraus, der nicht nur Ausschüttungen, sondern auch Wertsteigerungen ermöglicht. Die meisten erfolgreichen Technologieunternehmen zahlen keine Dividenden, sondern investieren konsequent in neue Technologien und Märkte – ein Kreislauf, der Nachhaltigkeit und Wachstum schafft.
Doch hier spielen Bildung und Mindset eine Schlüsselrolle. Es beginnt damit, dass Wissenschaftler und Technologen enger zusammenarbeiten und gegenseitigen Respekt entwickeln. Peter Drucker hat das treffend beschrieben: Technologists sind „hands on“, während Scientists „minds on“ sind. Es geht jedoch nicht um ein Gegeneinander, sondern um ein Zusammenspiel von Minds On und Hands On – gerade in komplexen Bereichen wie dem autonomen Fahren.
Ein aktuelles Beispiel ist die jüngste Finanzierungsrunde von Waymo, einem Unternehmen im Robotaxi-Segment, das Ende Oktober mit 5,6 Milliarden Dollar bewertet wurde und eine Marktkapitalisierung von 45 Milliarden Dollar erreicht hat. Während Europa weiterhin darüber debattiert, wie Zölle mit China ausgehandelt werden, drohen wir erneut eine Schlüsseltechnologie zu verpassen – ähnlich wie bei der Batterietechnologie im Automobilbereich.
Europa sollte vielmehr auf seine Stärken setzen, insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Zuverlässigkeit, wo wir weltweit führend sind. Der jährliche Weltkongress für autonomes Fahren in Wien zieht Experten aus der ganzen Welt an, doch es gelingt uns nicht, daraus echte Traktion für die europäische Innovationslandschaft zu generieren. Hier müssen wir ansetzen, um unsere Position in der globalen Technologielandschaft zu stärken.
Wie kann eine stärkere Vernetzung zwischen Wissenschaft, Industrie und Ausbildung dazu beitragen, dass Unternehmen in Österreich und Europa langfristig wettbewerbsfähiger werden?
Bei TTTech versuchen wir, diesen Fortschritt aktiv voranzutreiben. Wir arbeiten kontinuierlich daran, neue Ansätze zu fördern und Unterstützung im Umfeld zu mobilisieren. Ich bin insgesamt zufrieden mit den Fortschritten, sehe jedoch großes Potenzial, durch bessere Kommunikation und eine stärkere Verzahnung von Wissenschaft und Technik noch mehr zu erreichen. Besonders in der Ausbildung setzen wir an: Wir unterstützen Studierende mit Stipendien, bieten Masterprogramme und begleiten Abschlussarbeiten.
TTTech engagiert sich auch aktiv in der Lehre. Unsere Mitarbeiter unterrichten an Fachhochschulen und Universitäten und betreuen wissenschaftliche Arbeiten bis hin zu Promotionen. Zudem haben wir mit den TTTech Labs eine Plattform geschaffen, um Innovationen gezielt zu fördern. Wir sind außerdem Teil eines starken Netzwerks, das insbesondere in Südosteuropa gut etabliert ist. Unser Ziel ist es, Brücken zwischen Wissenschaft und Technik zu bauen und den Austausch zu intensivieren – wir stehen auf einer Seite der Brücke und ermutigen andere, mit uns den Übergang zu gestalten.