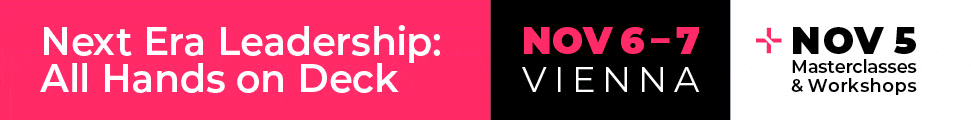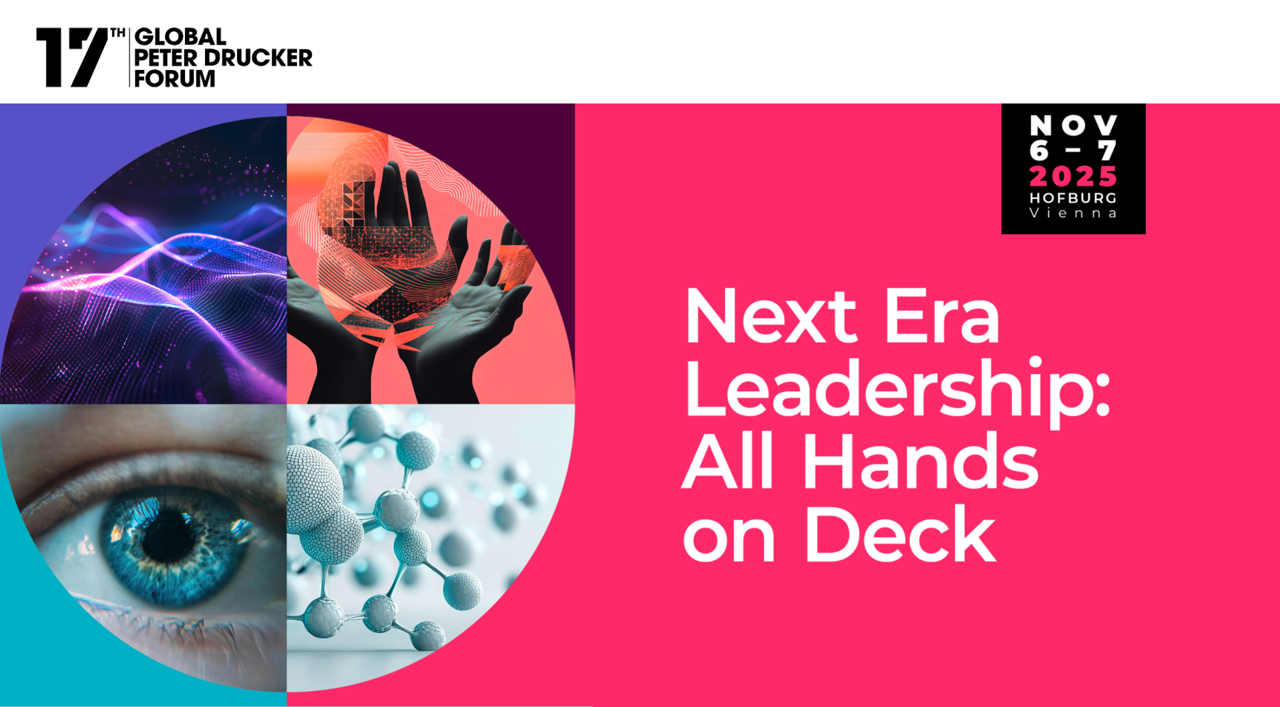Innovation und Wettbewerbsfähigkeit sind in der heutigen globalisierten Wirtschaft entscheidend. Ein zentraler Indikator für den Fortschritt eines Landes ist die Anzahl der jährlich angemeldeten Patente. Wie steht es in diesem Bereich um Europa und Österreich und welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich in der aktuellen wirtschaftlichen Lage? Und welche Möglichkeiten ergeben neue Technologien wie Künstliche Intelligenz in der Entwicklung und Verwaltung von Patenten? xBN hat dazu mit Roland Kraml, Counsel bei ABP Patent Network, ein Interview geführt.
Wie viele Patente werden jährlich weltweit angemeldet?
Weltweit werden jährlich etwa 3,5 Millionen neue Patente angemeldet, wobei ein erheblicher Anteil aus China stammt – etwa eine Million. Auch die USA, Japan und Südkorea sind wichtige Akteure, gefolgt von Europa, wo Deutschland eindeutig die führende Rolle einnimmt. Deutschland kann als das „Epizentrum“ der Patentanmeldungen in Europa betrachtet werden und übertrifft andere Länder wie Frankreich deutlich.
Wie sieht es in Österreich aus?
Österreich hat in den letzten zwei Jahrzehnten ebenfalls Fortschritte gemacht. Besonders seit Anfang der 2000er Jahre gab es durch politische Initiativen einen klaren Push, die Zahl der Patentanmeldungen zu steigern. Diese Maßnahmen, wie gezielte Förderung und Unterstützung, haben Früchte getragen, und die Anzahl der Anmeldungen ist deutlich gestiegen. Dennoch ist die Zahl der Patente stark von der Innovationskraft und Investitionsfähigkeit der Industrie abhängig.
Im Vergleich zu Deutschland gibt es in Österreich allerdings weniger Unternehmen, die mehrere Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung (F&E) investieren können. In Deutschland gibt es zahlreiche Firmen, die zwei, vier oder sogar bis zu 20 Milliarden Euro in F&E stecken und dementsprechend hohe Patentzahlen generieren. In Österreich hingegen ist die Grundlage kleiner, aber das Land hat dennoch einige echte Vorreiter. Besonders die TU Wien sticht mit herausragender Patentqualität hervor. Trotzdem finden die Entwicklungen in Deutschland in einer ganz anderen Größenordnung statt.
Wie reagieren Unternehmen in der aktuellen wirtschaftlichen Lage auf den Kostendruck?
Es wird derzeit in vielen Unternehmen gespart, und das teils in erheblichem Maße. Ein Beispiel: Im September letzten Jahres habe ich 60 Gespräche mit kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) sowie größeren Konzernen in Deutschland geführt – und bis auf zwei oder drei Fälle haben alle Maßnahmen zur Kostenreduktion ergriffen. Diese reichen von Werkschließungen über Zwangsurlaub bis hin zu Kurzarbeit.
Im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) ist die Situation jedoch differenzierter. Viele Entwicklungsprojekte haben sehr lange Laufzeiten, weshalb Unternehmen bei einem kurzfristigen konjunkturellen Abschwung oft zögern, diese einzuschränken. Der Grund ist klar: Einsparungen in F&E können langfristige Folgen haben, die sich als Innovationslücke erst Jahre später zeigen – und das möchte man vermeiden. Daher versuchen Unternehmen, solche Phasen möglichst zu überbrücken. Gelegentlich werden alternative Sparmaßnahmen gewählt, um die F&E-Budgets zu schonen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass F&E häufig zu den Kernwerten eines Unternehmens gehört, und diese gibt man nur ungern auf. Dennoch gibt es in besonders kritischen Branchen, wie etwa der Automobilindustrie und deren Zulieferern, auch Fälle massiver Einsparungen, bis hin zu vollständigen Ausgabensperren („Spending-Freeze“). Solche Entscheidungen sind oft davon geprägt, abzuwarten, wie sich politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen entwickeln.
Zu den strukturellen Herausforderungen kommt in Deutschland das Thema der Energiepreise, das viele Unternehmen stark belastet. Trotzdem wird in den meisten Fällen versucht, Kürzungen im Bereich F&E und bei Patenten auf ein Mindestmaß zu beschränken. Manche Unternehmen legen dabei sogenannte „Sparziele“ fest, die alle Bereiche betreffen, um intern Fairness zu signalisieren und den Zusammenhalt zu fördern. Das Ziel ist, nicht nur bei den Mitarbeitenden in der Produktion zu sparen, sondern alle Abteilungen gleichermaßen einzubeziehen. Dennoch bleibt F&E für viele Unternehmen der Bereich, in dem Kürzungen oft nur als absolute Notlösung gesehen werden.
Welche Optionen haben Unternehmen bei der Patentanmeldung, und wie können unterschiedliche Ansätze Kosten und strategische Ziele beeinflussen?
Patentanmeldungen erfolgen in der Regel über die nationalen Patentämter. In China beispielsweise werden die meisten Patente beim chinesischen Patentamt eingereicht, während in den USA die Anmeldungen über das dortige Amt erfolgen. Die entsprechenden Patentdaten können entweder direkt abgerufen oder geliefert werden, denn grundsätzlich sind nahezu alle Patente öffentlich einsehbar. Eine wichtige Rolle spielt die Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO), eine Schwesterorganisation der UNO mit Sitz in Genf. Über ihre Plattform können alle international angemeldeten Patente eingesehen werden, da die Datenbank öffentlich und über das Internet zugänglich ist.

Es ist faszinierend, sich vorzustellen, dass eine KI nicht nur eine Erfindung entwickelt, sondern auch das zugehörige Patent eigenständig erstellen könnte.
Eine Ausnahme bilden Geheimpatente, oftmals in sicherheitsrelevanten Bereichen wie Nuklearwaffen. Solche Patente werden zwar eingereicht, jedoch nicht veröffentlicht. Abgesehen davon sind jedoch die meisten Patente öffentlich zugänglich. In Europa ist das größte Patentamt das Europäische Patentamt (EPO) mit Hauptsitz in München. Erfinder haben dort die Möglichkeit, ihre Patente entweder über nationale Patentämter oder direkt über den europäischen Anmeldeweg einzutragen.
Gibt es unterschiedliche Modelle, um ein Patent anzumelden?
Eine neue, kosteneffiziente Variante ist das Einheitspatent („Unitary Patent“), das eine alternative Kostenstruktur bietet. Während die Anmeldung und die ersten Jahre günstiger sind, steigen die Kosten am Ende der Laufzeit von 20 Jahren. Dieses Modell ist besonders attraktiv für Startups und kleinere Unternehmen, die zunächst prüfen möchten, ob ihre Erfindung wirtschaftlich erfolgreich ist und sich kommerzialisieren lässt. Sollte sich nach einigen Jahren zeigen, dass das Patent keine ausreichenden Erträge generiert, kann man es einfach auslaufen lassen und die hohen Langzeitkosten vermeiden – eine intelligente Lösung zur Kostenoptimierung.
Welche Strategie sich letztlich als die richtige erweist, hängt stark vom Einzelfall ab. Manche Unternehmen sichern ihre Innovationen nur im eigenen Land ab, weil sie dort ihren Hauptmarkt sehen und Nachahmungen im Ausland für sie keine große Rolle spielen. Andere verfolgen hingegen eine strengere Schutzpolitik und melden Patente in mehreren Ländern oder internationalen Märkten an.
ABP hat in Zusammenarbeit mit IBM und Red Hat die KI-gestützte Software patentbutler.AI entwickelt. Wie unterstützt sie Unternehmen bei der effizienten Analyse großer Mengen an Patenten?
Ein praktisches Beispiel kann die Vorteile unserer Lösung verdeutlichten: Eine Kundin aus Berlin, ein kleines Unternehmen mit vergleichsweise wenigen Patentanmeldungen – etwa zwei bis vier im Monat –, steht vor der Herausforderung, monatlich rund 1.000 Patente im Monitoring-Prozess zu überprüfen. Ziel ist es, potenzielle Risiken rechtzeitig zu identifizieren. Dieser Vorgang bindet enorm viel Zeit und erfordert, sich in die teils äußerst komplexe Sprache der Patente einzuarbeiten und ihre Inhalte zu analysieren. Tatsächlich erweisen sich davon 800 bis 850 Patente regelmäßig als irrelevant.
Hier setzt unsere KI an: der sogenannte “Patentbutler”, genau die patentbutler.AI. Sie filtert diese irrelevanten Einträge sofort heraus, bietet jedoch die Möglichkeit, sie bei Bedarf einzusehen. Der entscheidende Mehrwert entsteht bei den 150 relevanten Patenten: Ohne Unterstützung der KI wäre eine tiefgehende Prüfung dieser Dokumente extrem zeitaufwändig. Unsere Lösung liefert hingegen auf Knopfdruck präzise Informationen, etwa welche Merkmale übereinstimmen, in welchem Kontext und mit welcher Relevanz. Dank ihres semantischen Verständnisses erkennt die KI sogar verklausulierte oder anders formulierte Inhalte, wodurch eine erhebliche Effizienzsteigerung erzielt wird.
Die Kundin, die zuvor vier Wochen mit der Bewältigung ihres Arbeitsaufkommens kämpfte und dabei oft überfordert war, ist nun in der Lage, die gleichen Aufgaben innerhalb von drei bis vier Tagen abzuschließen. Diese Veränderung stellt eine erhebliche Verbesserung ihres Arbeitsalltags dar. Sie hat nun endlich die Kapazität, sich auf strategisch wichtige Themen zu konzentrieren – etwa den Aufbau eines klar strukturierten Prozesses für den Umgang mit neuen Erfindungen, was bisher nicht in der gewünschten Systematik möglich war. Darüber hinaus bleibt ihr Zeit für strategische Planung und die zukünftige Ausrichtung ihrer Tätigkeit. Ihr Kopf ist wieder frei, und sie kann ihre Arbeit auf einem völlig neuen Niveau angehen.
Wie verändert der Einsatz von KI zur Generierung und Patentanmeldung von Erfindungen die Innovationslandschaft, und welche Vorteile hat Europa durch seine fortschrittliche Gesetzgebung in diesem Bereich?
Eine spannende Entwicklung, die zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Nutzung von KI nicht nur für Verwaltungsaufgaben, Analysen, Monitoring oder das Verfassen von Texten, sondern auch für die Generierung von Erfindungen selbst. In Deutschland gibt es bereits eine rechtliche Grundlage, die es erlaubt, Patente auf durch KI entwickelte Innovationen anzumelden. Das bedeutet, dass nicht nur die Patentschrift, sondern auch die zugrunde liegende Erfindung von einer KI stammen kann.
Auch hier ist die patentbutler.AI ein gutes Beispiel. Bereits jetzt übernimmt sie zahlreiche Aufgaben und erspart enorm Kosten und Zeit. Denn der Patentanwalt kann komplexe Täigkeiten mit Hilfe des „Patentbutlers“ viel effizienter und schneller ausführen. Der Mensch bleibt jedoch der Entscheider und natürlich auch der tatsächliche Erfinder, wird namentlich im Patent aufgeführt und erhält die entsprechende Vergütung.
Wohin könnte diese Entwicklung führen?
Immer mehr KI-Systeme werden in der Lage sein, eigenständig Erfindungen zu generieren – sei es in der Materialforschung, der Wirkstoffentwicklung, der Biochemie oder im Maschinenbau. KI könnte beispielsweise neuartige Ansätze für Stoßdämpfer oder Achsen entwickeln, selbst in Bereichen, in denen man kaum noch mit revolutionären Innovationen rechnet. Die deutsche Gesetzgebung, die solche KI-generierten Patente erlaubt, könnte in Zukunft als Vorbild für ganz Europa dienen. Damit hat Deutschland einen Vorteil gegenüber den USA, wo aktuell noch ein Mensch als Erfinder zwingend vorgeschrieben ist. Ob die USA in diesem Bereich nachziehen werden, bleibt abzuwarten.
Langfristig dürfte diese Entwicklung zu einem Innovationsschub führen, der sowohl die Anzahl registrierter Patente als auch die Qualität der technologischen Lösungen steigert. Es ist faszinierend, sich vorzustellen, dass eine KI nicht nur eine Erfindung entwickelt, sondern auch das zugehörige Patent eigenständig erstellen könnte.
Wie realistisch ist Ihrer Meinung die Annahme, dass KI Berufe wie Steuerberater oder Notare vollständig ersetzen wird, und in welchen Bereichen bleibt menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar?
Bei Notaren ist das schwer einzuschätzen, da ich die rechtlichen Rahmenbedingungen in diesem Bereich nicht genau kenne. Dort sehe ich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben gewisse Hürden. Allerdings ist die Situation bei Steuerberatern eine andere. Ich habe vor ein paar Monaten mit der Geschäftsführung von Datev gesprochen, dem führenden Anbieter in Deutschland für Lohnabrechnung und ähnliche Dienstleistungen. Mit über 4.000 IT-Fachkräften verfügen sie über umfassendes Know-how im Bereich Automatisierung und KI. Ihrer Einschätzung zufolge könnte es in wenigen Jahren Steuerberater im herkömmlichen Sinn kaum noch geben.
Natürlich wird es nach wie vor Experten geben, die strategisch beraten – etwa wenn es darum geht, Betriebsstätten oder Headquarters so zu strukturieren, dass sie steuerlich optimal aufgestellt sind. Doch die rein administrative Tätigkeiten, wie das Sammeln, Sortieren, Einreichen und Abwickeln von Steuerunterlagen, wird vollständig automatisiert werden. Ich schätze, dass dieser Wandel spätestens bis 2027, wenn nicht sogar früher, abgeschlossen sein wird.
Zur Person
Roland Kraml hat über 15 Jahre Erfahrung in Führungspositionen und als selbständiger Unternehmer. Nach seinem Wechsel in die Patentbranche wirkte er beim Aufbau eines der weltweit größten IP-Dienstleisters mit und wurde CEO des Unternehmens. Kraml war unter anderem für die Geschäftsentwicklung in 28 Ländern verantwortlich. In dieser Funktion betreute und beriet er sowohl kleine Forschungseinrichtungen, zahlreiche Unternehmen des forschenden Mittelstandes wie auch internationale Konzerne. Er war in führender Funktion in einer Münchner Patentanwaltskanzlei tätig, gründete mehrere Unternehmen in unterschiedlichen Branchen und berät Startups. Roland Kraml begleitet im Auftrag von ABP die Co-Creation der generativen KI Patentbutler.AI mit IBM und deren Markteinführung.