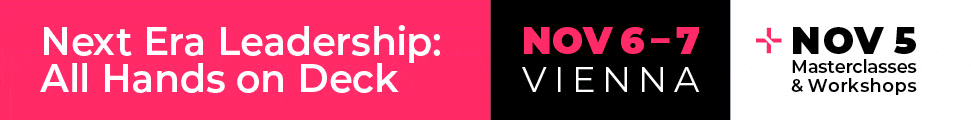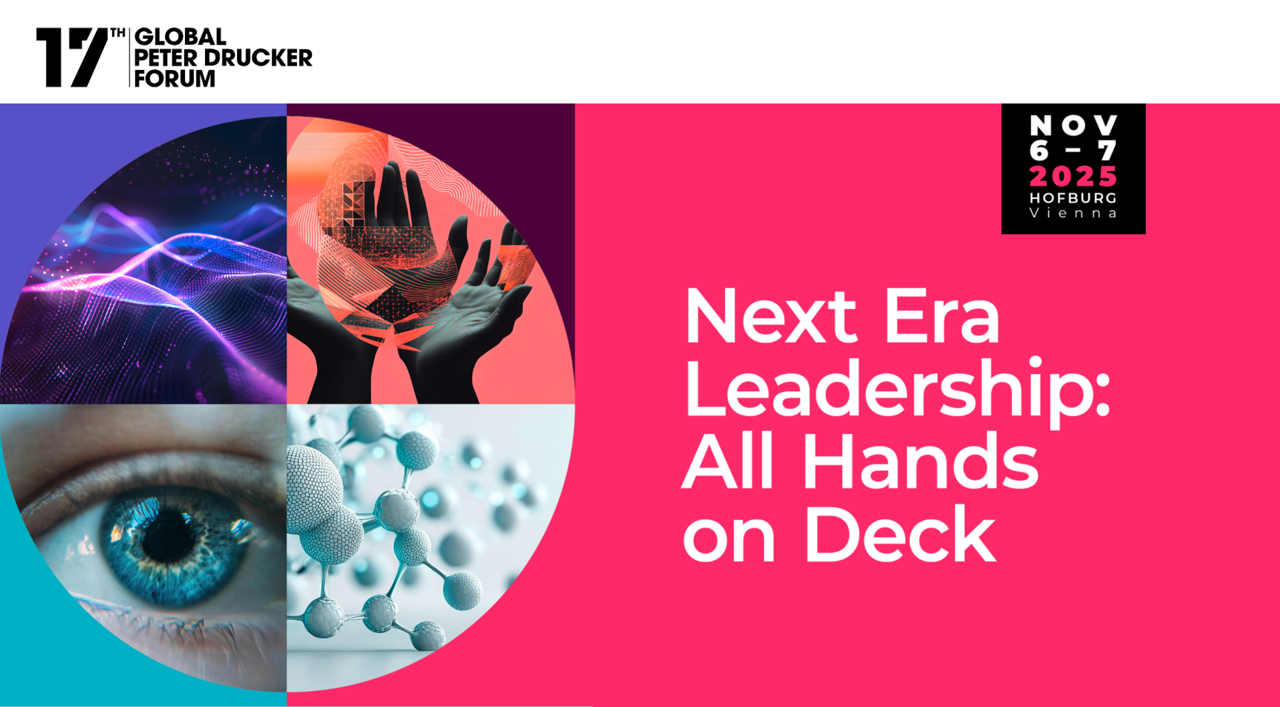Mahnende Worte von Benedikt Franke, stellvertretender Vorsitzender und CEO der Münchner Sicherheitskonferenz, bei den Starnberger See Gesprächen vergangene Woche.
„Der Spaß ist vorbei. Ich komme ja von der dunklen Seite der Macht“, eröffnete Benedikt Franke seinen Vortrag bei den Starnberger See Gesprächen – und lächelte trocken. Er wolle Klartext sprechen — aber deshalb nicht sofort die Stimmung dämpfen, sondern eine Ermutigung aussprechen. Was folgte, war ein schonungsloser Weckruf: Nicht die künstliche Intelligenz wäre das primäre Problem, sondern unsere politisch-strategische Trägheit, unsere Selbsttäuschungen und die Abhängigkeiten, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben. Nun wäre es an der Zeit, das zu korrigieren.
Franke weiter: Europa wisse sehr genau, was zu tun sei. „Wir kommen aber nur langsam voran.“ Aus dieser Langsamkeit erwachsen strategische Verwundbarkeiten, sagt er — und diese werden gezielt ausgenutzt. Seine Diagnose ist klar, seine Sprache ungewohnt direkt: „Hope is a shit strategy.“ Hoffen und moralische Entrüstung allein seien keine Sicherheitspolitik.
Fünf Aufgabenfelder (und Baustellen), in denen Europa handeln muss
Franke skizzierte fünf konkrete Handlungsfelder — keine abstrakten Prinzipien, sondern praktische Baustellen, an denen sich der Kurs Europas messen lassen muss.
- Strategische Autonomie
Deutschland und Europa müssen auf eigene Füße kommen. Das Potenzial sei vorhanden, und es sei groß, so Franke; die politische Entschlossenheit fehle. Europa dürfe nicht dauerhaft auf fremde Lieferanten, Technologien oder Führungswillen hoffen. Die Abhängigkeiten — ökonomisch wie technologisch — sind nach seiner Darstellung keine bloßen Versorgungsfragen, sondern geopolitische Schwachstellen. - Reduktion von Klumpenrisiken und Aufbau alternativer Lieferketten
Als drastisches Beispiel nannte er die Konzentration seltener Erden: „China hält aktuell 90+ Prozent“, so Franke in seinen Notizen — eine Macht, die zur Hebelwirkung werden könne. Sun Tzu-gleich formulierte er das strategische Dilemma: “Wenn du den Feind in diesem Tal nicht besiegst, versuch ein anderes Tal.” Europa brauche Diversifizierung — neue Partner, neue Märkte, neue Quellen. - Partnerschaften statt paternalistischer Belehrung
Der globale Süden fühle sich oft vor den Kopf gestoßen: „Wir dürfen die Länder, die früher benachteiligt wurden, nicht weiter übergehen.“ Franke warnte vor Doppelmoral und forderte echte Partnerschaften. Verteidigung bestehe nicht nur aus Waffen und Drohnen; wirtschaftliche, soziale und diplomatische Verflechtungen sind Teil moderner Sicherheitsarchitektur. - Reform der globalen Regierungsarchitektur — die UN stärken und entpolitisieren
Die internationale Ordnung sei zunehmend politisiert und damit blockiert. Es könne nicht sein, dass von 5 Ländern in einem Meeting drei nicht miteinander sprechen. Franke erinnerte daran, dass viele wichtige Entscheidungen heute in alternativen Foren getroffen würden — und stellte die Frage, wer die Antworten liefert, wenn neue Pläne zur internationalen Ordnung auftauchen. Die UN müsse wieder handlungsfähig werden – und dazu müssen wir sie entpolitisieren, also: wieder in Verhandlungen eintreten. - Wirklich zuhören — Absichten anderer Player ernst nehmen und antizipieren
„Wir machen immer wieder den Fehler, dass wir Leuten nicht zuhören, wenn sie uns sagen, was sie machen werden.“ Das gelte für Russland, für China, für andere Akteure. Aussagen wie Putins öffentliche Positionen oder Xis Ambitionen gegenüber Taiwan dürften nicht als Rhetorik abgetan werden; sie müssten in Strategien übersetzt werden, die über Rhetorik hinausgehen.
Von imperialen Kalkülen und dem nächsten Krieg
Franke zeichnete ein Bild, in dem alte Imperien und neue Geostrategen die Spielregeln verändern. Tendenzen würden darauf hindeuten, dass Akteure sich nicht nur auf Verteidigungsbereitschaft einstellen, sondern auf die Absicht, Macht durchzusetzen — mit Mitteln, die nicht immer konventionell sein werden. „Sie kennen das Zitat: Man bereitet sich immer auf den letzten Krieg vor. Wir sollten uns aber auf den nächsten/übernächsten vorbereiten — und der wird vielleicht nicht nur mit Drohnen geführt.“
Die Warnung war konkret: Russlands Haltung, seine Möglichkeiten — und die Frage, ob Europa und Verbündete den politischen Druck erzeugen, der nötig wäre, um aggressive Pläne zu durchkreuzen. Franke nannte Stimmen, die bereits 2029 eine verstärkte russische Entschlossenheit erwarten; er rief dazu auf, Zähigkeit und strategische Weitsicht zu zeigen statt in „Schnappatmung“ zu verfallen.
Kein Verstecken hinter Werten — Pouvoir für schwierige Entscheidungen
Ein wiederkehrendes Thema in Frankes Vortrag: Werte sind wichtig — aber nicht als Deckmantel, hinter dem sich handlungsunwillige Politik verstecken darf. Europa müsse handlungsfähig werden und bereit sein, Macht zu nutzen, um schwierige, aber notwendige Entscheidungen zu treffen. Dazu gehöre auch, alte Gewohnheiten zu überwinden: „Wir wissen oft, was zu tun ist — wir tun es nur nicht schnell genug.“
Fazit: Realismus statt Illusionen
Am Ende war Frankes Appell einfach und scharf: Der Spaß ist vorbei — wer das Spielfeld der Geopolitik betreten hat, muss die Regeln ernst nehmen. Europa hat Ressourcen und Potenzial, aber es braucht klare Prioritäten, strategische Autonomie, Diversifizierung und echte Partnerschaften. Politische Rhetorik allein reicht nicht; es sind konkrete, vielfach schwierige Entscheidungen gefragt.
Sein Schlusswort blieb im Ton seines Vortrags: Direkt, ein wenig provokant, aber wachrüttelnd. „Hoffnung ist keine Strategie.“ Wer Europa ernst nimmt, muss jetzt handeln — bevor andere die Lücken füllen, die wir ihnen zu lange offenlassen.